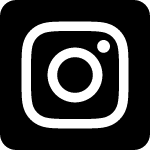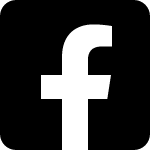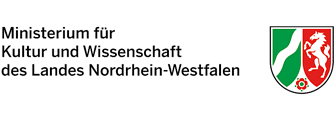Vom Verschwinden – eine Einführung
Der steigende Meeresspiegel verschluckt Stück für Stück ganze Inselstaaten. Jeden Tag sterben bis zu 150 Tierarten aus. Etwa die Hälfte aller anerkannten Sprachen wird bald von keiner lebenden Person mehr gesprochen. Lebenswelten, Familienmodelle und Berufsgruppen weichen neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Flucht- und Exilerfahrungen reißen Lücken in Biografien. Angriffskriege bedrohen kollektive Identitäten, und Erinnerungskultur ist ein kontrovers diskutiertes Politikum. – Die Wuppertaler Literatur Biennale widmet sich in ihrer siebten Ausgabe dem vielschichtigen Motto »Vom Verschwinden«.
Um das titelgebende Phänomen greifbar zu machen, scheint die Literatur das optimale Medium zu sein: Das Schreiben vermag zum einen zu erhalten, zu konservieren, aber auch zu selektieren und wirkt damit aktiv auf die Art und Weise ein, wie wir als Gesellschaft erinnern oder vergessen. Zum anderen kann Literatur nicht nur den Prozess des Verschwindens beschreiben, sondern auch wie keine andere Kunstform das Abwesende erfahrbar machen.
Entgegen der anfangs erwähnten Beispiele aus unserer globalen Lebensrealität begreift die Literatur der Gegenwart das Verschwinden nicht durchweg als gewaltsames oder nostalgisches Element: Hier offenbart es sich oft als Metamorphose oder als einziger Ausweg aus einer Sackgasse und wird durch eine bewusste Entscheidung zum radikalen Kurswechsel, zum Aufbruch in etwas Neues. Der Blick zurück dient dabei lediglich der Spurensuche, dem Verständnis der Gegenwart durch das Füllen von Leerstellen.
Die rein literarische Perspektive wird im Programm der diesjährigen Wuppertaler Literatur Biennale wieder um diskursive Veranstaltungen bereichert: Wir freuen uns, dass die Autorin Asal Dardan zwei Panels kuratiert hat und als Gastgeberin moderieren wird, die zwei hochaktuelle Schlaglichter auf das diesjährige Motto werfen.
Auch die lokale Literatur- und Kulturszene leistet einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt der thematischen Aspekte: Samstag, der 4. Mai ist ausschließlich Autor*innen aus der Region gewidmet. Darüber hinaus wurden Wuppertaler AkteurInnen und Initiativen erstmals über einen Open Call eingeladen, Begleitformate zum Programm zu entwickeln. Der Beitrag »grieving spaces« von Ida Schiele und Avan Weis, eine Ausgabe der Reihe »HörenSagen« des Literaturhauses, eine Veranstaltung von Decolonize Wuppertal zu Sussy Dakaro und ein interdisziplinärer Beitrag zu Fragen der künstlichen Intelligenz der Firma Siegersbusch ergänzen das Lesungsprogramm um innovative Veranstaltungsformate »made in Wuppertal«.
Die Wuppertaler Literatur Biennale präsentiert im Jahr 2024 unter dem Motto »Vom Verschwinden« AutorInnen, die mit hoher gesellschaftspolitischer Relevanz Themen beleuchten, die unseren Blick auf die Gegenwart und in die Zukunft prägen, aber auch poetische, ästhetische Elemente des Verschwindens in den Blick nehmen. In diesem Jahr ermöglicht erstmalig ein Festivalticket den Besuch aller Veranstaltungen der Wuppertaler Literatur Biennale – wir laden also herzlich ein, uns und viele wunderbare GästInnen bei den Erkundungen des Verschwindens zu begleiten.
Ruth Eising, Thorsten Krämer, Torsten Krug, Julia Wessel, KuratorInnen der Wuppertaler Literatur Biennale 2024
mit herzlichem Dank an Luisa Banki, Birte Fritsch, Matei Chihaia, Katja Schettler, Antonius Weixler, Bettina Paust und das Team des Kulturbüros.